19. Februar 2012
Eigentlich sollte das hier ein kurzer und augenzwinkernder Bericht über einen Hammer-Fund vor einigen Tagen werden. Nun ist er ziemlich lang und nicht mehr ganz kindgerecht, aber es muss ja mal gesagt werden!
 Das Heidentheater trieb sich nämlich in der Umgebung der Heidenkate herum und stieß auf einen Schaukasten. (Moderne Zeit natürlich – sowas hatten Wikinger noch nicht, und Runensteine sind zur Verbreitung von Terminen leider zu umständlich anzufertigen…) In diesem machte die Kirchengemeinde Haddeby Werbung für ihren Kinderbibelnachmittag – mit einem Thorshammer! Die evangelischen Pfandfinder in Haddeby nennen sich “Ansgars Erben” nach dem missionarischen Mönch und späteren Bischof Ansgar von Bremen, der als Apostel des Nordens gilt.
Das Heidentheater trieb sich nämlich in der Umgebung der Heidenkate herum und stieß auf einen Schaukasten. (Moderne Zeit natürlich – sowas hatten Wikinger noch nicht, und Runensteine sind zur Verbreitung von Terminen leider zu umständlich anzufertigen…) In diesem machte die Kirchengemeinde Haddeby Werbung für ihren Kinderbibelnachmittag – mit einem Thorshammer! Die evangelischen Pfandfinder in Haddeby nennen sich “Ansgars Erben” nach dem missionarischen Mönch und späteren Bischof Ansgar von Bremen, der als Apostel des Nordens gilt.
Ask und Embla erleben oft, dass der Hammer als Amulett auch in der modernen Zeit von vielen Leuten getragen wird. Einige tun das nach wie vor, weil sie dadurch an Thors Kampf gegen die riesischen Urgewalten erinnert werden, die einen auch als modernen Menschen bedrohen können. Im Winter scheinen die Eisriesen ja immer wieder die Herrschaft über unsere Gegend zu übernehmen. Das bringt vor allem Menschen in ihren ochsenlosen Schnellwagen, in sogenannten “Autos”, oft in große Schwierigkeiten. Somit könnte ein Thorshammer als Schutzamulett gerade für Reisende gelten, zumal auch Thor häufig mit einem Wagen unterwegs ist. Dieser wird allerdings nicht von Ochsen gezogen, sonder ist ein total hipper Ziegenwagen. Doch dazu irgendwann mehr.
 Dann gibt es die vielen Menschen, die den Mjöllnir tragen, weil er für sie zur Metal-Musik gehört. Das haben Embla und Ask zuerst gar nicht verstanden, weil sie auch vom Metal wenig Ahnung hatten. Aber sie wissen inzwischen, dass diese Musikrichtung um 1990 stark von der skandinavischen Metal-Szene beeinflusst wurde, aus der unter Verwendung der örtlichen Mythologie in den Texten dann der Pagan- und der Viking-Metal entstanden. So kann man es jedenfalls ganz kurz beschreiben, richtige Fachleute für Metal sind Embla und Ask nicht. Sie wissen immerhin, dass sich Amon Amarth trotz der üppigen Verwendung des Mjöllnirs als Bandsymbolik nicht als Viking-Metal-Band, sondern als Death-Metal-Band bezeichnet – Nicht, weil der Bandname nichts mit Wikingern zu tun hat, sondern aus dem `Herrn der Ringe´ stammt, sondern weil sich diese Einteilung nur “auf den textlichen Aspekt, nicht aber auf die Musik” bezieht. Die zusammenfassende Bezeichnung `Viking Metal´ für Bands wie Enslaved, Einherjer, Ensiferum und Thurisaz sei “völliger Quatsch [...], weil das völlig verschiedene Bands sind.” (Zitat Johan Hegg). Übrigens fand einer der ersten Auftritte des Heidentheaters vor einigen Wikingern statt, die maßgeblich an den Bühnenshows für Amon Amarth und Manowar beteiligt sind!
Dann gibt es die vielen Menschen, die den Mjöllnir tragen, weil er für sie zur Metal-Musik gehört. Das haben Embla und Ask zuerst gar nicht verstanden, weil sie auch vom Metal wenig Ahnung hatten. Aber sie wissen inzwischen, dass diese Musikrichtung um 1990 stark von der skandinavischen Metal-Szene beeinflusst wurde, aus der unter Verwendung der örtlichen Mythologie in den Texten dann der Pagan- und der Viking-Metal entstanden. So kann man es jedenfalls ganz kurz beschreiben, richtige Fachleute für Metal sind Embla und Ask nicht. Sie wissen immerhin, dass sich Amon Amarth trotz der üppigen Verwendung des Mjöllnirs als Bandsymbolik nicht als Viking-Metal-Band, sondern als Death-Metal-Band bezeichnet – Nicht, weil der Bandname nichts mit Wikingern zu tun hat, sondern aus dem `Herrn der Ringe´ stammt, sondern weil sich diese Einteilung nur “auf den textlichen Aspekt, nicht aber auf die Musik” bezieht. Die zusammenfassende Bezeichnung `Viking Metal´ für Bands wie Enslaved, Einherjer, Ensiferum und Thurisaz sei “völliger Quatsch [...], weil das völlig verschiedene Bands sind.” (Zitat Johan Hegg). Übrigens fand einer der ersten Auftritte des Heidentheaters vor einigen Wikingern statt, die maßgeblich an den Bühnenshows für Amon Amarth und Manowar beteiligt sind!  \m/
\m/
Leider wird der Thorshammer auch von Leuten aus der rechten Szene getragen (die sich oft nicht als “rechts”, sondern als “nationalkonservativ” bezeichnen), und die in Germanen und Wikingern Leute sehen, die sich gegen “fremde Einflüsse” vor allem aus “südlichen Ländern” kämpferisch zur Wehr setzten. Das zeigt einmal mehr, wie krampfhaft die Weltbilder dieser Menschen sind und wie wenig sie sich für Tatsachen interessieren. Die geschichtliche Überlieferung ist durchaus geprägt von Berichten über kriegerische Raubzüge der Wikinger. Die Archäologen finden jedoch immer wieder Belege, dass das Leben der Wikinger nicht allein aus Kampf und Raub und dem menschenverachtenden aber lukrativen Sklavenhandel bestand. Ihre an Kunstfertigkeiten reiche Kultur begründete sich in langer Tradition auf Austausch und Neugier mit und auf fremden Kulturen inklusive ihrer jeweiligen Handwerkstechniken, Gebräuche und Weltbilder. Die familiären Verbindungen waren zwar wichtig, häufig wurde allerdings auch jemand “fremdes” in die Sippe aufgenommen und, so zeigen uns aufwändige Bestattungen, nach Leistung für die Gemeinschaft und nicht nach Herkunft, Aussehen oder Behinderung beurteilt. Die Tradition so einer Haltung belegen nicht nur nordeuropäische Funde aus der mitteren Bronzezeit. Die königswürdige Oseberg-Bestattung für zwei Frauen, die mit ihrer Herkunft aus der Schwarzmeerregion in Skandinavien als “Ausländerinnen” zu bezeichnen sind, bietet diesbezüglich ein wikingerzeitliches Beispiel, das nicht ins braune Weltbild der Rassenquassler passt. Die Interpretation der sterblichen Überreste, wonach die eine der beiden Frauen vielleicht behindert gewesen sein könnte, erst recht nicht!
 Als Amulett getragen sollten besonders die prächtigsten der vielen Thorshammerfunde wahrscheinlich ein trotziges Festhalten an den alten Göttern deutlich machen, denn sie stammen aus der Zeit, als sich das Christentum immer stärker im Norden ausbreitete. Berühmt ist in diesem Zusammenhang der Pragmatismus, den Handwerker der Wikingerzeit mit der Verwendung von Gussformen sowohl für Kreuzamulette als auch für Thorshämmer an den Tag legten. So etwas gefällt Ask und Embla!
Als Amulett getragen sollten besonders die prächtigsten der vielen Thorshammerfunde wahrscheinlich ein trotziges Festhalten an den alten Göttern deutlich machen, denn sie stammen aus der Zeit, als sich das Christentum immer stärker im Norden ausbreitete. Berühmt ist in diesem Zusammenhang der Pragmatismus, den Handwerker der Wikingerzeit mit der Verwendung von Gussformen sowohl für Kreuzamulette als auch für Thorshämmer an den Tag legten. So etwas gefällt Ask und Embla!
Zum Kotzen finden sie dagegen den Missbrauch dieses Symbols von Menschen, die sich durch Intoleranz auszeichnen! Die Tolenranz des Heidentheaters hat dort ein Ende, wo sie Meinungen tolerieren müsste, die letztendlich Toleranz und Meinungsfreiheit abschaffen wollen. Wie viele andere Heiden haben sie keinen Bock mehr, dass die unsinnige Verwendung des Thorhammers durch einzelne Nazis ihn (zumeist südlich der Elbe) in so ein Zwielicht stellt!
Um zum Anfang des Artikels zurück zu kommen: Es gibt gerade in Schleswig-Holstein viele Leute, die einen Thorshammer allein aus archäologisch-geschichtlichem Interesse heraus tragen oder ihn vielleicht als Symbol für ihre heimatlichen Wurzeln sehen. Sie denken sich dabei nichts Heidnisches oder gar Politisches. Auch das finden Embla und Ask sehr schön.
Die beiden nehmen nicht an, dass sich die Christen in Haddeby bei der Verwendung des Hammers mehr gedacht haben als dass er ein archäologischer Fund aus nächster Nachbarschaft ist. Ein interessanter Fund, in dem Kreuz und Hammer miteinander verbunden sind – vielleicht sollte das Heidentheater über ihn mal ein Stück spielen? (Wer unsere Vorstellungen schon erlebt hat, weiß eventuell, warum Ask einen Thorshammer “mit einem Nupsi unten dran” trägt.  ) Wohlmöglich wurde dieser Hammer auch im Ansgarhaus in eine kindgerechte Geschichte über die “Heidenmission” eingebunden? Embla und Ask meinen jetzt aber, dass das Thema Mission ein heißes Eisen ist, welches den Rahmen dieses Artikels endgültig sprengen würde. Das Heidentheater hat mit seinen Auftritten jedenfalls keine missionarischen Absichten. Wenn Kinder Spaß an den Geschichten haben, dann liegt das sowohl an der noch heute spürbaren Faszination der nordischen Mythologie als auch am abenteuerlichen Ruf der Wikinger. Den benutzt die Jugendarbeit von St. Andreas in Haddeby ebenfalls. Und schändlicherweise tun das leider auch diejenigen, die sonst auf Eso-Quatsch-Symbole abfahren…
) Wohlmöglich wurde dieser Hammer auch im Ansgarhaus in eine kindgerechte Geschichte über die “Heidenmission” eingebunden? Embla und Ask meinen jetzt aber, dass das Thema Mission ein heißes Eisen ist, welches den Rahmen dieses Artikels endgültig sprengen würde. Das Heidentheater hat mit seinen Auftritten jedenfalls keine missionarischen Absichten. Wenn Kinder Spaß an den Geschichten haben, dann liegt das sowohl an der noch heute spürbaren Faszination der nordischen Mythologie als auch am abenteuerlichen Ruf der Wikinger. Den benutzt die Jugendarbeit von St. Andreas in Haddeby ebenfalls. Und schändlicherweise tun das leider auch diejenigen, die sonst auf Eso-Quatsch-Symbole abfahren…
21. Februar 2011
In Nordfriesland werden regelmäßig am 21. Februar zur Biike großen Brennholzhaufen mit einer Puppe gekrönt, die dann in den Flammen des entzündeten Haufens verbrennt. Worum geht es da? Ist das wirklich ein uralter heidnischer Brauch, wie es in Texten der Tourismusverbände und der regionalen Zeitungen oft heißt? Ask und Embla haben sich schlaugemacht:

Auf der Hallig Hooge wird die Biike bei Landsend aufgebaut (oder heißt es “an Landsend?), direkt am Meeresrand. Das liegt ganz schön entlegen, und die Schafe werden die für diese Jahreszeit ungewohnte Betriebsamkeit der Vorbereitungen sicher erstaunt zur Kenntnis genommen haben.

Der Brennholzhaufen ist beeindruckend hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass es auf dieser Hallig kaum Bäume gibt. Früher wurden auf den Halligen die Öfen mit getrocknetem Dung, sogenannten ‘Ditten’ befeuert, und dann kann natürlich auch noch Treibholz zum Heizen verwendet werden. Aber soviel Holz treibt gar nicht an. Hatten die Leute damals gegen Ende des Winters überhaupt noch etwas für den Aufbau eines Großfeuers übrig? Das erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Angeblich bestand das Biikefeuer ja auch mal aus einer Tonne auf einer Stange, die mit Stroh und Teer befüllt war und deren Flammen in der Dunkelheit Zeichen setzten. Das klingt schon wahrscheinlicher, wenn wir uns die alten Biikefeiern in einer Zeit vorstellen, in der Heizmaterial nicht mit dem LKW oder durch die Leitung geliefert wird. Aber wem galten die Zeichen?

In einigen Texten, die zur Biike auffindbar sind, heißt es, dass “schon in den ältesten Schriftquellen dieser Region” das Biikebrennen als “urheidnische Praxis” erwähnt wird. Hm, Ask und Embla haben bisher gedacht, dass die ältesten Schriftquellen dieser Region die alten Kirchbücher sind, und diese vermerkten die Geburts-, Tauf-, Hochzeits- und Sterbedaten der Menschen. So war das, bis dann die weltlichen Standesämter erfunden wurden. Die Biike sei “ein Opferfeuer für das Gedeihen der neuen Saat” gewesen? Also zumindest auf Hooge war Ackerbau nicht der Dreh- und Angelpunkt der Tätigkeiten, die den Menschen früher das Überleben sicherten und für deren Gelingen möglicherweise verantwortlichen Göttern geopfert wurde. Das Meer war dazu höchstwahrscheinlich wichtiger. Und die Schriftquellen aus Asks und Emblas heidnischer Zeit schweigen sich über große Opferfeuer oder dergleichen sowieso aus. Dann gibt es ja noch die Erklärung, dass “mit den Feuern früher die Walfänger verabschiedet wurden”. Zu all diesen Theorien hat allerdings MartinM schon so viel zusammengetragen, dass wir auf seinen Artikel verweisen.


Das Heidentheater stellte somit fest: Nix genaues weiß man nicht. Aber als es den vertrauenswürdigen Bericht von der Hooger Biike 2011 hört, wird das Bild um die Biike deutlicher!
- Es sei gaaaanz wichtig, dass die Winterpuppe in Flammen aufgeht, damit der Winter endet. (Hat der Feuerwehrmann gesagt, der auch für das Anzünden der Biike zuständig war.) Das ist passiert, und promt wurde daraufhin die Wetterlage frühlingshafter, nachdem sich zuvor sogar wieder Eisschollen auf der Nordsee gebildet hatten. Damit ist wohl mal wieder deutlich geworden, wie eng die Beziehungen zwischen Menschen und Puppen sind, jawoll!
- Egal seit wann es die großen Holzhaufen zur Biike gibt, sie sind einfach klasse! Ohne den großen Feuerberg wären die kälteerprobten Berichterstatter sicherlich erfroren, denn -7° können bei Wind direkt am Meer verflixt eisig sein! Das war früher wohl auch schon so. (Das deutet Tante Ilse an, die über 90 ist und auf der Hallig lebt. Sie berichtet, dass sie früher selten zur Biike gegangen ist, weil es ja immer so kalt sei um diese Jahreszeit.) Also für wen auch immer – große Feuer machen wärmer!
- Und was mögliche Opfergaben betrifft: Gegen Spende konnte man sich mit Punsch und Glühwein von Innen wärmen. Die Spenden gehen ganz pragmatisch und völlig unheidnisch an die Hooger Kirchengemeinde…

17. März 2010
Ask und Embla packen gerade den Ochsenkarren, denn sie wollen zu einer Feier mit Freunden fahren. Beim Packen gibt es spannende Gespräche über eine Begegnung während einer Zeitreise mit einem Mann aus der Zukunft, der sich als Sprachwissenschaftler bezeichnete.
Er erzählte den beiden, dass in seiner Zeit das bevorstehende Fest oft “Ostara-Fest” genannt werde, denn seinen Zeitgenossen sei die Göttin des Frühlings und der Morgenröte jetzt meist unter dem Namen “Ostara” bekannt. Die meisten Menschen seiner Zeit würden jedoch ein christliches Fest feiern, das hierzulande “Ostern” genannt werde.
Wer oder was ist Ostara?
Ostarafeste sind Feiern zu Ehren einer Frühlingsgöttin, die meist Ostara genannt wird. Über die Festtraditionen oder über die Göttin selbst ist durch die Geschichtsschreibung kaum etwas überliefert. Am Beispiel des Ostarafestes kann deutlich gemacht werden, wie schwierig manchmal die Rekonstruktion von alten, nur in Spuren überlebenden Traditionen ist.
Zeitpunkt für das christliche Osterfest ist der erste Sonntag nach dem Frühjahrsvollmond, also der erste Vollmond nach der Tagundnachtgleiche. Durch viele uralte Zeugnisse vergangener Kulturen wissen wir um die Bedeutung, die diese astronomischen Beobachtungen schon vor tausenden von Jahren gehabt haben. Diese besonderen Zeitpunkte im Jahr werden immer schon von Feierlichkeiten begleitet worden sein. Da viele christliche Bräuche auf diese ältere Traditionen zurückgehen, wurde ganz einfach angenommen, dass hinter dem Termin für das christliche Osterfest eine Feier zu Ehren einer heidnischen Frühjahrs-Gottheit stehe.
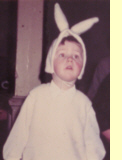 Der Name des christlichen Auferstehungsfestes unterscheidet sich mit “Ostern” im Deutschen und mit “Easter” im Englischen von den Bezeichnungen in anderen Ländern Europas. Dazu ein Auszug aus Wikipedia: “Viele Sprachen bezeichnen das Osterfest mit einer Wortableitung vom aramäischen pas-cha, angelehnt an das hebräische Wort Pessach, unter anderem: Dänisch: påske, Finnisch: pääsiäinen, Französisch: Pâques, [...] Isländisch: páskar, Italienisch: Pasqua, Niederländisch: pasen, Portugiesisch: Páscoa, Rumänisch: pas,ti [...] Schwedisch: påsk, Spanisch: Pascua”. Es wird vermutet, dass die Bezeichnung “Ostern” mit dem Namen dieser alten Gottheit zusammenhängt. Es gab die Annahme, Jacob Grimm hätte den dazu passenden Namen “Ostara” für diese Frühjahrs-Gotthiet erfunden beziehungsweise aus dem althochdeutschen Monatsnamen “Ostarun” abgeleitet. Dieser sehr simplen Herleitung stellte sich soviel Kritik entgegen, dass es in der Folge dann hieß, eine Frühlingsgöttin namens Ostara hätte es nie gegeben, eine vorchristliche Tradition sei daher auch fragwürdig. In einem Artikel auf den Seiten des Eldarings erläutert Kurt Oertel, was von diesen Vermutungen und Herleitungen zu halten ist. Hier der Artikel, auf den wir uns im folgenden Absatz dankend beziehen.
Der Name des christlichen Auferstehungsfestes unterscheidet sich mit “Ostern” im Deutschen und mit “Easter” im Englischen von den Bezeichnungen in anderen Ländern Europas. Dazu ein Auszug aus Wikipedia: “Viele Sprachen bezeichnen das Osterfest mit einer Wortableitung vom aramäischen pas-cha, angelehnt an das hebräische Wort Pessach, unter anderem: Dänisch: påske, Finnisch: pääsiäinen, Französisch: Pâques, [...] Isländisch: páskar, Italienisch: Pasqua, Niederländisch: pasen, Portugiesisch: Páscoa, Rumänisch: pas,ti [...] Schwedisch: påsk, Spanisch: Pascua”. Es wird vermutet, dass die Bezeichnung “Ostern” mit dem Namen dieser alten Gottheit zusammenhängt. Es gab die Annahme, Jacob Grimm hätte den dazu passenden Namen “Ostara” für diese Frühjahrs-Gotthiet erfunden beziehungsweise aus dem althochdeutschen Monatsnamen “Ostarun” abgeleitet. Dieser sehr simplen Herleitung stellte sich soviel Kritik entgegen, dass es in der Folge dann hieß, eine Frühlingsgöttin namens Ostara hätte es nie gegeben, eine vorchristliche Tradition sei daher auch fragwürdig. In einem Artikel auf den Seiten des Eldarings erläutert Kurt Oertel, was von diesen Vermutungen und Herleitungen zu halten ist. Hier der Artikel, auf den wir uns im folgenden Absatz dankend beziehen.
 Da das Ableiten von Götternamen auf Namen für Personen bekannt sei, stützten entsprechende altangelsächsische Namensteile die Existenz einer namensgebenden Gottheit, von der im beginnenden 8.Jahrhundert berichtet werde. Diese Göttin des Frühlings oder der Morgenröte kann folglich bei den Angelsachsen Britanniens den Namen Eostre gehabt haben. Austro wäre dann die altgermanische Form. Mit der Überlieferung des Namens “Matronis Austriahenis” auf Weihesteinen um 200 n.d.Z. sei außerdem eine namensähnliche Göttin im Matronenkult belegt, aber kein Namensbeweis für die gesuchte Frühlingsgöttin der Morgenröte erbracht. So kommt es, dass in unseren Regionen eine Göttin des Frühlings und der Mörgenröte unter verschiedenen Namen verehrt werden kann: Ostara, Austro, Eostra oder Eostre.
Da das Ableiten von Götternamen auf Namen für Personen bekannt sei, stützten entsprechende altangelsächsische Namensteile die Existenz einer namensgebenden Gottheit, von der im beginnenden 8.Jahrhundert berichtet werde. Diese Göttin des Frühlings oder der Morgenröte kann folglich bei den Angelsachsen Britanniens den Namen Eostre gehabt haben. Austro wäre dann die altgermanische Form. Mit der Überlieferung des Namens “Matronis Austriahenis” auf Weihesteinen um 200 n.d.Z. sei außerdem eine namensähnliche Göttin im Matronenkult belegt, aber kein Namensbeweis für die gesuchte Frühlingsgöttin der Morgenröte erbracht. So kommt es, dass in unseren Regionen eine Göttin des Frühlings und der Mörgenröte unter verschiedenen Namen verehrt werden kann: Ostara, Austro, Eostra oder Eostre.
Um ein Ostarafest “richtig” zu feiern, kann es nicht wichtig sein, dass nur felsenfest sicher überlieferte Tradition befolgt wird. Traditionen haben immer Entwicklungen durchlaufen, ansonsten würden wir heute noch Jagdwild auf Höhlenwände malen oder seltsame Figuren in Felsen hineinritzen – alles andere wäre moderne Blasphemie. Also dürfen wir die Feiern Ostara zu Ehren nach eigenen Möglichkeiten und Begabungen gestalten. Das können wir unter Einbeziehung von buntgefärbten Eiern, Blumenschmuck, schweigend im Morgengrauen geschöpftem Osterwasser, Hefezöpfen, der Grünen Neune, gutem Essen und schönen Opfergaben, die eventuell in ein Feuer gegeben werden. Zur Frage, woher denn farbige Eier zu Ostern kommen und was es mit der Grünen Neune auf sich hat, gibt es hier einen Link zu einem Frühlings-Artikel von Ulrike auf den Eldaring-Seiten.

Embla und Ask schmunzeln immer noch, wenn sie an den gequälten Gesichtsausdruck des Sprachwissenschaftlers denken, der ihnen erzählte, dass viele seiner Zeitgenossen “Ostara” auf der zweiten Silbe betonen. Richtig wäre die Betonung auf der ersten Silbe, wie bei den Wörtern “Vatertag” oder “Hasenkult”. Schließlich würden auch die Christen das Wort “Ostern” gemäß der germanischen Stammsilbenbetonung korrekt auf der ersten Silbe betonen. Aber was er auch alles anhören müsse, wo doch so viel Wissen über diese Göttin der Sprachwissenschaft zu verdanken sei!
Ask und Embla trösten ihn: Eine Frühlingsgöttin kann uns auf unterschiedlichsten Wegen und in vielfacher Gestalt erscheinen, schließlich ist sie Göttin. Sie wird wissen, wie unsere Feiern gemeint sind, unabhängig von Brauchtum, Benennung oder Betonung…
 Das Heidentheater trieb sich nämlich in der Umgebung der Heidenkate herum und stieß auf einen Schaukasten. (Moderne Zeit natürlich – sowas hatten Wikinger noch nicht, und Runensteine sind zur Verbreitung von Terminen leider zu umständlich anzufertigen…) In diesem machte die Kirchengemeinde Haddeby Werbung für ihren Kinderbibelnachmittag – mit einem Thorshammer! Die evangelischen Pfandfinder in Haddeby nennen sich “Ansgars Erben” nach dem missionarischen Mönch und späteren Bischof Ansgar von Bremen, der als Apostel des Nordens gilt.
Das Heidentheater trieb sich nämlich in der Umgebung der Heidenkate herum und stieß auf einen Schaukasten. (Moderne Zeit natürlich – sowas hatten Wikinger noch nicht, und Runensteine sind zur Verbreitung von Terminen leider zu umständlich anzufertigen…) In diesem machte die Kirchengemeinde Haddeby Werbung für ihren Kinderbibelnachmittag – mit einem Thorshammer! Die evangelischen Pfandfinder in Haddeby nennen sich “Ansgars Erben” nach dem missionarischen Mönch und späteren Bischof Ansgar von Bremen, der als Apostel des Nordens gilt. Dann gibt es die vielen Menschen, die den Mjöllnir tragen, weil er für sie zur Metal-Musik gehört. Das haben Embla und Ask zuerst gar nicht verstanden, weil sie auch vom Metal wenig Ahnung hatten. Aber sie wissen inzwischen, dass diese Musikrichtung um 1990 stark von der skandinavischen Metal-Szene beeinflusst wurde, aus der unter Verwendung der örtlichen Mythologie in den Texten dann der Pagan- und der Viking-Metal entstanden. So kann man es jedenfalls ganz kurz beschreiben, richtige Fachleute für Metal sind Embla und Ask nicht. Sie wissen immerhin, dass sich Amon Amarth trotz der üppigen Verwendung des Mjöllnirs als Bandsymbolik nicht als Viking-Metal-Band, sondern als Death-Metal-Band bezeichnet – Nicht, weil der Bandname nichts mit Wikingern zu tun hat, sondern aus dem `Herrn der Ringe´ stammt, sondern weil sich diese Einteilung nur “auf den textlichen Aspekt, nicht aber auf die Musik” bezieht. Die zusammenfassende Bezeichnung `Viking Metal´ für Bands wie Enslaved, Einherjer, Ensiferum und Thurisaz sei “völliger Quatsch [...], weil das völlig verschiedene Bands sind.” (Zitat Johan Hegg). Übrigens fand einer der ersten Auftritte des Heidentheaters vor einigen Wikingern statt, die maßgeblich an den Bühnenshows für Amon Amarth und Manowar beteiligt sind!
Dann gibt es die vielen Menschen, die den Mjöllnir tragen, weil er für sie zur Metal-Musik gehört. Das haben Embla und Ask zuerst gar nicht verstanden, weil sie auch vom Metal wenig Ahnung hatten. Aber sie wissen inzwischen, dass diese Musikrichtung um 1990 stark von der skandinavischen Metal-Szene beeinflusst wurde, aus der unter Verwendung der örtlichen Mythologie in den Texten dann der Pagan- und der Viking-Metal entstanden. So kann man es jedenfalls ganz kurz beschreiben, richtige Fachleute für Metal sind Embla und Ask nicht. Sie wissen immerhin, dass sich Amon Amarth trotz der üppigen Verwendung des Mjöllnirs als Bandsymbolik nicht als Viking-Metal-Band, sondern als Death-Metal-Band bezeichnet – Nicht, weil der Bandname nichts mit Wikingern zu tun hat, sondern aus dem `Herrn der Ringe´ stammt, sondern weil sich diese Einteilung nur “auf den textlichen Aspekt, nicht aber auf die Musik” bezieht. Die zusammenfassende Bezeichnung `Viking Metal´ für Bands wie Enslaved, Einherjer, Ensiferum und Thurisaz sei “völliger Quatsch [...], weil das völlig verschiedene Bands sind.” (Zitat Johan Hegg). Übrigens fand einer der ersten Auftritte des Heidentheaters vor einigen Wikingern statt, die maßgeblich an den Bühnenshows für Amon Amarth und Manowar beteiligt sind! ![]() \m/
\m/ Als Amulett getragen sollten besonders die prächtigsten der vielen Thorshammerfunde wahrscheinlich ein trotziges Festhalten an den alten Göttern deutlich machen, denn sie stammen aus der Zeit, als sich das Christentum immer stärker im Norden ausbreitete. Berühmt ist in diesem Zusammenhang der Pragmatismus, den Handwerker der Wikingerzeit mit der Verwendung von Gussformen sowohl für Kreuzamulette als auch für Thorshämmer an den Tag legten. So etwas gefällt Ask und Embla!
Als Amulett getragen sollten besonders die prächtigsten der vielen Thorshammerfunde wahrscheinlich ein trotziges Festhalten an den alten Göttern deutlich machen, denn sie stammen aus der Zeit, als sich das Christentum immer stärker im Norden ausbreitete. Berühmt ist in diesem Zusammenhang der Pragmatismus, den Handwerker der Wikingerzeit mit der Verwendung von Gussformen sowohl für Kreuzamulette als auch für Thorshämmer an den Tag legten. So etwas gefällt Ask und Embla!![]() ) Wohlmöglich wurde dieser Hammer auch im Ansgarhaus in eine kindgerechte Geschichte über die “Heidenmission” eingebunden? Embla und Ask meinen jetzt aber, dass das Thema Mission ein heißes Eisen ist, welches den Rahmen dieses Artikels endgültig sprengen würde. Das Heidentheater hat mit seinen Auftritten jedenfalls keine missionarischen Absichten. Wenn Kinder Spaß an den Geschichten haben, dann liegt das sowohl an der noch heute spürbaren Faszination der nordischen Mythologie als auch am abenteuerlichen Ruf der Wikinger. Den benutzt die Jugendarbeit von St. Andreas in Haddeby ebenfalls. Und schändlicherweise tun das leider auch diejenigen, die sonst auf Eso-Quatsch-Symbole abfahren…
) Wohlmöglich wurde dieser Hammer auch im Ansgarhaus in eine kindgerechte Geschichte über die “Heidenmission” eingebunden? Embla und Ask meinen jetzt aber, dass das Thema Mission ein heißes Eisen ist, welches den Rahmen dieses Artikels endgültig sprengen würde. Das Heidentheater hat mit seinen Auftritten jedenfalls keine missionarischen Absichten. Wenn Kinder Spaß an den Geschichten haben, dann liegt das sowohl an der noch heute spürbaren Faszination der nordischen Mythologie als auch am abenteuerlichen Ruf der Wikinger. Den benutzt die Jugendarbeit von St. Andreas in Haddeby ebenfalls. Und schändlicherweise tun das leider auch diejenigen, die sonst auf Eso-Quatsch-Symbole abfahren…





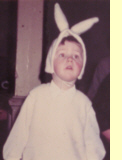
 Da das Ableiten von Götternamen auf Namen für Personen bekannt sei, stützten entsprechende altangelsächsische Namensteile die Existenz einer namensgebenden Gottheit, von der im beginnenden 8.Jahrhundert berichtet werde. Diese Göttin des Frühlings oder der Morgenröte kann folglich bei den Angelsachsen Britanniens den Namen Eostre gehabt haben. Austro wäre dann die altgermanische Form. Mit der Überlieferung des Namens “Matronis Austriahenis” auf Weihesteinen um 200 n.d.Z. sei außerdem eine namensähnliche Göttin im Matronenkult belegt, aber kein Namensbeweis für die gesuchte Frühlingsgöttin der Morgenröte erbracht. So kommt es, dass in unseren Regionen eine Göttin des Frühlings und der Mörgenröte unter verschiedenen Namen verehrt werden kann: Ostara, Austro, Eostra oder Eostre.
Da das Ableiten von Götternamen auf Namen für Personen bekannt sei, stützten entsprechende altangelsächsische Namensteile die Existenz einer namensgebenden Gottheit, von der im beginnenden 8.Jahrhundert berichtet werde. Diese Göttin des Frühlings oder der Morgenröte kann folglich bei den Angelsachsen Britanniens den Namen Eostre gehabt haben. Austro wäre dann die altgermanische Form. Mit der Überlieferung des Namens “Matronis Austriahenis” auf Weihesteinen um 200 n.d.Z. sei außerdem eine namensähnliche Göttin im Matronenkult belegt, aber kein Namensbeweis für die gesuchte Frühlingsgöttin der Morgenröte erbracht. So kommt es, dass in unseren Regionen eine Göttin des Frühlings und der Mörgenröte unter verschiedenen Namen verehrt werden kann: Ostara, Austro, Eostra oder Eostre. 